Tag 45: Im Reich der 1000 Jahre alten Giganten
Serendipity â Teil 1

Montag, 24. Dezember 2012 â Heiligabend
Eureka â Orick â Eureka
»Why?«
»Because of the bears.«
BĂ€ren? Ich wollte daraufhin wissen, wie hoch die Chance oder Gefahr ist, BĂ€ren zu begegnen. TagsĂŒber, erklĂ€rte Connor, kommen sie nicht in die NĂ€he von Menschen. Sobald es aber dunkel wird, benutzen sie dieselben Pfade. Einfach, weil es wesentlich stressfreier ist, ĂŒber gemachte Wege anstatt durchs GebĂŒsch zu laufen. Ergibt Sinn.
Am Morgen ist Connor bereits weg. Er trifft sich mit Freunden zum Wildwasserkanufahren. Das wĂ€re mir zu kalt heute â speziell nach dieser Nacht.
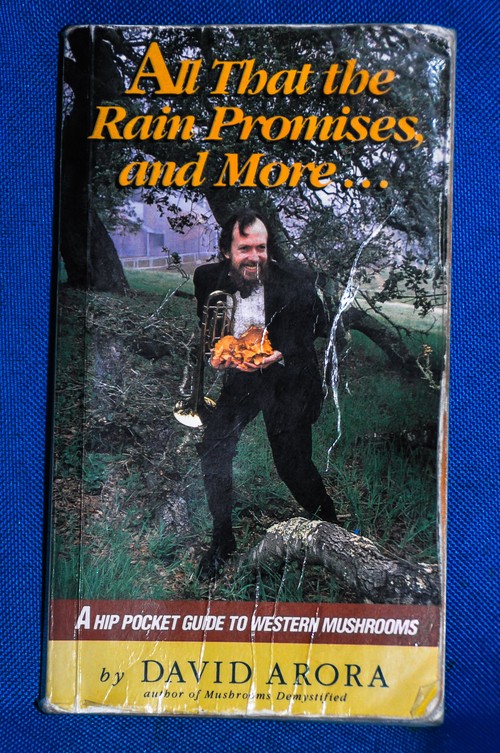
Connor hat uns gestern neben der BĂ€renwarnung auch Wandertipps und eine Karte gegeben. Unser erstes Ziel ist Orick. Hier wollen wir erst einmal frĂŒhstĂŒcken. Der Weg ins 70 Kilometer nördlich gelegene Dörfchen fĂŒhrt an der KĂŒste vorbei. Es ist dieselbe Route, die wir gestern Abend gekommen sind. Bei Tageslicht offenbart die Landschaft nun ihre ganze Schönheit. Zu unserer Linken ist der Ozean, rechts grĂŒne HĂŒgel und WĂ€lder. Noch bevor ich Cari dazu auffordern kann Fotos zu machen, verlangt sie schon die Kamera. Sie knipst wie ein Weltmeister, flucht aber bei jedem zweiten Schnappschuss, weil der Autofokus zu lange braucht, um sich einzustellen. Dementsprechend toll werden viele ihrer Fotos.
Nach annĂ€hernd 60 Kilometern passieren wir ein gelbes Verkehrsschild, auf dem vor Elchen gewarnt wird, die die StraĂe kreuzen könnten. WundertĂŒte Kalifornien: Hier gibt es neben Schnee und BĂ€ren auch Elche? Wir passieren ein weiteres Schild, das vor den kreuzenden Elchen warnt und zusĂ€tzlich dazu einlĂ€dt, rechts abzubiegen, um die Elche zu sehen: »Turn in at Little Red School House â See worldâs largest Roosevelt elk herd.«
Also biegen wir in den Redwood Trails Circle ab und tuckern dem roten kirchenĂ€hnlichen HolzhĂ€uschen entgegen. Links steht eine imposante, ebenso rot gestrichene alte Holzscheune, die mit groĂen weiĂen Lettern beschriftet wurde: »Redwood Gift Store«. Daneben parken einige Caravans. Wir befinden uns auf dem Areal des Stone Lagoon Campground, einem RV Park, der sich direkt am Dry Lagoons State Park und am Humboldt Lagoons State Park befindet. Der Schutz der Natur scheint in dieser Gegend groĂ geschrieben zu werden. Das knallrote kleine Schulhaus mit den weiĂ gestrichenen Kanten und dem kleinen TĂŒrmchen ist heute ein Souvenirladen und Museum. Ein altes Feuerwehrauto steht direkt daneben auf der Wiese. Rund um das zentral auf einer grĂŒnen Wiese gelegene Little Red School House und das daneben abgestellte Feuerwehrauto liegen und grasen Dutzende Elche â die gar keine Elche sind: Elk ist im amerikanischen Englisch der Rothirsch oder auch der Wapiti. Der Elch heiĂt moose. Die Roosevelt Elks, die hier grasen und faulenzen, sind Wapiti. Das lustige Wort kommt von den Shawnee und bedeutet »weiĂes Hinterteil«. Ja, und das haben alle Anwesenden. Die Wapiti geben mit dieser Kulisse ein tolles Bild ab. Die Herde scheint einen hohen Frauenanteil zu haben. Zumindest sehe ich nicht allzu viele Geweihe. Es sind auch viele Jungtiere dabei.
Wir wollen nicht noch mehr Zeit zum Wandern verlieren und fahren nach zehn Minuten wieder weiter.
Die Wellen des Pazifik treffen auf den langen Strand, der sich direkt neben dem KĂŒstenhighway entlangzieht. Wenig spĂ€ter erreichen wir Orick. Der kleine Ort scheint nur aus einer StraĂe zu bestehen. Der prominenteste Bewohner der Gegend wird vor einem GeschĂ€ft mit einer lebensgroĂen Holzstatue geehrt: Es ist Bigfoot oder Sasquatch, wie er auch genannt wird.

»Hello«, begrĂŒĂe ich die Kleine, als ihr GroĂvater die LadenflĂ€che betritt. WĂ€hrend wir den alten Mann fragen, ob es irgendwo im Ort die Möglichkeit gibt, etwas Essbares zu bekommen, können wir nicht aufhören, uns im Laden umzusehen. Ăberall liegen antike und verstaubte ElektrogerĂ€te und Handwerksutensilien â das Sortiment ist nicht nur alt, sondern dĂŒrfte zudem mindestens aus zweiter Hand stammen. Der Alte weist uns darauf hin, dass Orick hinter der BrĂŒcke noch weitergeht. Wir hatten die 300 Meter entfernte ĂberfĂŒhrung tatsĂ€chlich als das Ende des Dorfes eingeschĂ€tzt und sie noch gar nicht ĂŒberquert. Direkt dahinter soll sich ein tolles CafĂ© befinden. Das klingt doch gut.
»Where do you guys come from?«
»Iâm originally from Arizona and heâs German.«
»How did you get here?«
»We want to see the redwoods.«
»Fantastic!«, freut er sich mit uns, »youâve made it to the most beautiful part of California!«
»Really? Thatâs awesome!«
Der schrullige Mann, seine mittlerweile dazugestoĂene und nicht minder schrullige Frau und die Enkeltochter begleiten uns noch nach drauĂen. GroĂe Worte der Verabschiedung gibt es keine, die Wege trennen sich einfach. Die Beendigung einer Kommunikation lĂ€uft hier offensichtlich etwas anders ab als in den StĂ€dten.
Unmittelbar hinter der BrĂŒcke befindet sich auf der linken Seite das Palm Cafe. Dass man sein von MammutbĂ€umen umzingeltes CafĂ© »Palm« nennt, soll wohl etwas Exotik ins Dörfchen bringen. Als wir das CafĂ© betreten, bleiben wir kurz in der TĂŒr stocken und schauen uns grinsend an. Was ist das denn? Der Laden ist purer Trash! Wo fange ich denn da am besten an? Die StĂŒhle sind orangefarbene PlastikschalenstĂŒhle aus den 70ern. Das ist noch das harmloseste Mobiliar. Rechts zieht sich ein Tresen quer und tatsĂ€chlich leicht schrĂ€g durch den kompletten Raum. Die davor angebrachten dunklen StĂŒhle stehen auf einem soliden Metallbein und sind im Boden verschraubt. Wieder einmal fĂŒhle ich mich wie in einem Film. WĂ€re es nicht ganz so trashig und hinterm Mond, könnte man den Tresen â aber nur den Tresen â mit dem im Diner von Hill Valley vergleichen. Jenem Diner, in dem Michael J. Fox alias Marty McFly nach seiner Zeitreise in die 50er auf Papa George trifft und feststellen muss, dass dieser ein ganz schöner Loser ist: »Lou, give me a milk. â Chocolate.«
Hinter dem Tresen kann man direkt in die offene KĂŒche blicken und die darin werkelnden Menschen, die allesamt ĂŒber 70 sind, bei ihrer Arbeit beobachten. Cari entfleucht beim Anblick ein geschocktes: »Oh, my gosh.«
Ich findâs super hier. Wir setzen uns an einen Tisch am Fenster â alle Tische im schmalen Palm Cafe stehen direkt am Fenster. Zum Ende der Ortsbeschreibung noch das Beste: An der Wand gegenĂŒber des Eingangs haben die Betreiber ihr eigenes kleines »Christmas Wonderland« aufgebaut. Hinter einem kniehohen, weiĂen ZĂ€unchen stehen gleich drei dramatisch pathetisch geschmĂŒckte WeihnachtsbĂ€ume. Engelchen sitzen auf der Spitze, die obligatorischen Lichterketten und Christbaumkugeln werden von aus Plastik geformtem Kunstschnee umsĂ€umt. Zwischen und vor den BĂ€umen stehen PĂŒppchen mit wallendem Haar und EngelskostĂŒmchen. Ein weiĂer Plastikengel, an dem sich entweder die Lichter der BĂ€ume reflektieren oder der tatsĂ€chlich mit einer Innenlichterkette versehen wurde, blĂ€st in die Trompete. Ach, es öffnet einem das Herz.
In Amerika gibt es seit den 80ern ĂŒbrigens eine »Weihnachtsbaumkontroverse«: Offiziell, um die Spaltung zwischen Staat und Kirche zu symbolisieren und um darauf aufmerksam zu machen, dass die USA ein Vielvölkerstaat mit den unterschiedlichsten Glaubensgemeinschaften sind, nennen viele Menschen und Gemeinden ihre BĂ€ume nicht Christmas tree, sondern holiday tree. Ich bin dieser Diskussion auch schon begegnet.
Es ist mittlerweile Mittag. Das FrĂŒhstĂŒck haben wir somit verpasst und die einzig vegane Mahlzeit, die angeboten wird, sind Pommes. Cari traut sich nach den gestrigen Erfahrungen in Grants Pass nicht mehr an Fleischexperimente in dĂŒnner besiedelten Gegenden, weshalb sie vorschlĂ€gt, dass wir uns einen groĂen Teller Fritten teilen.
Ich denke, dass das Ambiente des Palm Cafe eigentlich nicht mehr gesteigert werden könnte. Kann es aber doch. Ein Mann mit Jogginghose und blauem Sweatshirt betritt die BĂŒhne. Der Mittvierziger trĂ€gt auĂerdem weiĂe Turnschuhe, eine Brille und einen Dreitagebart. So weit so unspektakulĂ€r. Das Famose trĂ€gt der gute Mann auf seinem Kopf. Es ist eine samtene, rote WeihnachtsmannmĂŒtze mit einem wild baumelnden, weiĂen Bommel daran. Er trĂ€gt die MĂŒtze mit solch ernster SouverĂ€nitĂ€t, als sei er einem Monty-Python-Film entsprungen. Es reagiert auch kein Mensch auf seine Kopfbedeckung. Als kĂ€me er tĂ€glich so ins CafĂ© wird er kurz und persönlich begrĂŒĂt und bekommt die Speisekarte auf den Tresen gelegt. Ach, herrlicher Laden!
Unsere Pommes kommen. Ich bin von der AbsurditĂ€t offensichtlich so eingenommen und angesteckt, dass ich mir wortlos eine Fritte auf die Serviette vor mir lege, sie vornehm mit Ketchup bestreiche, salze und pfeffere. Ein Schuss scharfer SoĂe dazu ⊠et voilĂ ! Dann nehme ich mir Messer und Gabel und beginne bei aufrechter Sitzhaltung mein Kartoffelsteak in mundgerechte HĂ€ppchen zu zerteilen und elegant zu mir zu nehmen. Cari sitzt mit höchst verstörtem Blick vor mir.
»Bon appétit.«
Sie quiekt auf, schnappt sich ebenfalls Messer, Gabel, Salz, Pfeffer und Ketchup und bereitet sich ihr eigenes kleines, gelbes Steak zu. Sie perfektioniert ihr Mittagessen mit geschmackvoll aufgetragenen KetchuppĂŒnktchen anstelle einer ausdrucksstarken Geraden. SchlieĂlich wollen wir auch satt werden. Langsames, bewusstes Essen unterstĂŒtzt die SĂ€ttigung. Das ist ja allgemein bekannt. Unsere kniggegerechte Essaktion scheint die alte Kellnerin mehr zu beeindrucken als der Herr Weihnachtsmann am Tresen es vermochte. Sie sagt nichts. Man kann ihr die Gedanken aber trotzdem ansehen: »Das mĂŒssen Kanadier sein.«
Also, wir haben SpaĂ.
Gegen Ende unseres Aufenthalts kommt eine der Damen vom Grill nach vorne an den Tresen und teilt der ungefÀhr 90-jÀhrigen Dame, die dort Platz genommen hat, mit, dass eine andere Köchin ein Weihnachtsgedicht verfasst hat. Sie soll es ihr vorlesen. Die Uroma will nicht und sagt der Oma, dass sie es ihr vorlesen soll.
»I canât read«, entgegnet diese wiederum, woraufhin unsere 65-jĂ€hrige Kellnerin die Situation regelt und lautstark das Weihnachtsgedicht vortrĂ€gt.
»Thatâs so nice«, sind sich am Schluss alle einig.
Wir lassen uns noch schnell versichern, dass wir auf dem richtigen Weg zu dem von Connor empfohlenen Newton B. Drury Parkway sind, und hauen ab. Einer der MĂ€nner meinte, die StraĂe sei zu dieser Jahreszeit sicherlich gesperrt. Das wagen wir aber zu bezweifeln. SchlieĂlich arbeitet Connor im Nationalpark und hĂ€tte uns sicherlich keinen Pfad empfohlen, der nicht zugĂ€nglich ist. Keine acht Kilometer hinter Orick biegen wir vom Redwood Highway ab. Der Newton B. Drury Parkway wird auch ausgeschildert. Die StraĂe wird links und rechts von einer grĂŒnen Wiese gesĂ€umt, die sich nach einigen Dutzend Metern im Nadelbaumwald verliert. Knapp zwei Kilometer spĂ€ter stehen wir vor einer Schranke. Der weitere Verlauf der StraĂe ist tatsĂ€chlich gesperrt. Das ist aber kein Problem, denn hier scheint unser Pfad zu beginnen. Wir stellen das Auto auf einem Parkplatz ab. Es gibt ein InformationshĂ€uschen, das allerdings geschlossen ist, Toiletten und eine Telefonzelle ⊠aus Holz.

AuĂer uns sind nur wenige andere Autos vor Ort. Allzu ĂŒberlaufen sollte es im Wald also nicht sein. Connor hat uns den Irvine Trail empfohlen. Hier sollen mĂ€chtige BĂ€ume wachsen, die ĂŒber 1000 Jahre alt sind. Der Pfad endet am Meer. Allerdings ist die Strecke so lang, dass es an einem Tag nahezu unmöglich ist, hin- und zurĂŒckzulaufen, ohne in die Dunkelheit zu geraten. Wir sind sowieso schon viel zu spĂ€t dran, weswegen eine Wanderung an die KĂŒste leider gar nicht erst infrage kommen kann.
Nach kurzer Zeit stellen wir fest, dass es sich bei dem eingeschlagenen Pfad lediglich um einen kleinen Rundweg am Waldrand entlang handelt, der uns wieder direkt zum Auto fĂŒhrt. Hm, das war wohl nichts. Der Vorteil unserer unfreiwilligen RĂŒckkehr zum Auto ist, dass wir uns unsere Jacken schnappen können. Es ist wirklich kĂŒhl im Wald. Wir gehen wieder ins Gehölz, folgen erneut den angegebenen Pfaden, passieren einen umgestĂŒrzten Mammutbaum, dessen liegender Stamm beeindruckend riesig ist, und beschlieĂen, als wir feststellen, dass alle Pfade wieder zurĂŒckfĂŒhren, uns einfach durchs Dickicht zu schlagen und unseren eigenen Weg zu gehen.
Allzu weit kommen wir aber nie. Entweder werden die BĂŒsche zu dicht, um hindurchzukommen, oder wir landen doch wieder auf dem Pfad. Anhand der Karte, die wir von Connor bekommen haben, versuchen wir herauszufinden, wo der verdammte Irvine Trail sein muss. Ein kleiner Fluss schlĂ€ngelt sich durch den Wald. Zwei prĂ€gnante Kurven sind eingezeichnet. Wir versuchen die Windungen zu finden. Bei einer dieser Windungen mĂŒsste es eine BrĂŒcke geben, die zum Irvine Trail fĂŒhrt. Als wir den breiten Bachlauf erreichen, sehen wir aber nur einen umgeworfenen, mit feuchtem Moos bewachsenen Stamm, der ĂŒber das GewĂ€sser fĂŒhrt.
»Competition?«, frage ich.
Wir beratschlagen kurz, ob es wirklich sinnvoll ist, so frĂŒh das Risiko einzugehen, bei diesen milden Temperaturen nass zu werden. Vielleicht, so ĂŒberlegen wir auch, ist der Bach ja nicht so tief und wir kommen mit feuchten Unterschenkeln durch. Dann mĂŒssten wir lediglich die FĂŒĂe wieder trocknen und könnten auf der anderen Seite weiterwandern. Nein, wir versuchen, noch einmal, den Irvine Trail zu finden. Also gehtâs erneut zurĂŒck zum Ausgangspunkt, wo wir auf einmal feststellen, dass wir nun schon zweimal wie die Blinden an einem weiteren Wegweiser vorbeimarschiert sind, der unter anderem den Irvine Trail ausweist. Mittlerweile ist es 14 Uhr. Wir folgen dem Pfad und kommen zur zuvor vergeblich gesuchten BrĂŒcke. Die BĂ€ume in diesem Bereich des Waldes sind noch höher und mĂ€chtiger als auf dem Rundweg. Feuchte Farne und dickes Moos hĂ€ngen von den Ăsten. Obwohl es nicht geregnet hat, tropft es von ihnen hinab. Die Natur ist wirklich beeindruckend schön.
Uns begegnen nur ein paar Wanderer, die sich bereits auf den RĂŒckweg machen. In den Wald hinein folgt uns niemand mehr. Nach einigen Minuten sind wir komplett alleine und hören auĂer unseren Schritten nur noch den Wald und das Wasser des nahen FlĂŒsschens. Ein Redwood scheint einfach abgeknickt zu sein. Wie nach einem Bombeneinschlag teilt sich der Stamm an der Bruchstelle in gewaltige, rote Splitter. Unter der Rinde verbirgt sich also offensichtlich das namengebende Rot der Hölzer. Der Aufschlag des Baumes muss so heftig gewesen sein, dass es sogar das komplette Wurzelwerk an die OberflĂ€che befördert hat. Es ist locker sechs Meter hoch. Was muss das nur fĂŒr einen Schlag gegeben haben?
Zwei andere BĂ€ume sind im Laufe der Jahrhunderte zu einem Baum zusammengewachsen. Die LĂŒcke, die ursprĂŒnglich zwischen ihnen war, ist mit Holz nachgewachsen und verdichtet sich bis weit nach oben.

Der Weg ist schön angelegt. Es ist ein reines Paradies. Cari und ich werden immer zĂ€rtlicher zueinander. Wir können keine fĂŒnf Meter gehen, ohne einander zu kĂŒssen und zu streicheln. Als wir einen recht breiten und noch lĂ€ngeren Baumstumpf entdecken, der sich wie ein Bett ĂŒber einen Hang legt, schauen wir uns kurz um. Wir sind alleine âŠ
Als die Sonne sich langsam senkt, verlassen wir den Wald.
Daraufhin fragt er: »Yeah?«, was ich wiederum mit einem lang gezogenen: »Yeeeah«, zu einem Ende bringe. Der Mann, der Mitte 40 sein dĂŒrfte und eigentlich gar nicht den Eindruck eines Hippies macht, verabschiedet uns mit den Worten: »Peace be with you.«
»Ciao«, erwidert Cari mit ihren offensichtlich ausgeprÀgten Italienischkenntnissen.
Auf dem Weg zurĂŒck zu Connors Haus kommen wir an einem kleinen Schlösschen vorbei, das ĂŒber und ĂŒber mit Lichterketten geschmĂŒckt ist. Erst bei meinen Recherchen erfahre ich, dass es sich hierbei um »the most grand Victorian home in America« handelt. Es ist unnötig zu erklĂ€ren, aus welchem Holz das 1886 fertiggestellte Haus erbaut wurde, das zunĂ€chst diversen Holzbaronen ein nobles Obdach bot. Benannt wurde das Anwesen nach seinem Bauherren, der von sich behauptete, der erste Mensch mit kommerziellen Absichten gewesen zu sein, der im Humboldt County einen Baum fĂ€llte. Die Carson Mansion ist das vermutlich meist fotografierte viktorianische Haus der USA und diente unter anderem als Vorlage fĂŒr den Uhrturm des Bahnhofs in Disneyland. Der Club der feinen Herrschaften, die es seit den 50ern in Beschlag haben, sperren die Ăffentlichkeit allerdings gĂ€nzlich aus.
Ich stelle den Wagen ab, um kurz ein paar Fotos von der Carson Mansion zu schieĂen, als auf einmal eine niedliche, kleine alte Dame neben mir steht.
»Isnât it beautiful?«, fragt sie mich.
»It is.«
»My granddaughter thinks they made it just for Christmas. I think it always looks like this.«
Ich will ihr die Illusion nicht nehmen, bin mir aber auch sicher, dass es reiner Weihnachtsschmuck ist. Ich erwidere daher nichts.
»Youâre from Eureka?«, möchte sie wissen.
Ich lĂ€chle: »No, Iâm from Germany.«
»Oh, Germany! How did you get here?«
»I wanted to see the redwoods. What about you? You live here?«
»No, I am visiting my granddaughter. Do you live in a hotel?«
Ich berichte ihr, wie ich reise. Sie findet es total aufregend: »Young people can travel like this. My granddaughter also travels like this. She also does this couch thing.«
»Really?«
In diesem Moment kommt die Enkelin, die im Auto auf ihre sĂŒĂe Oma wartete und sich wohl mittlerweile wunderte, was sie so lange mit dem bĂ€rtigen Fremden zu besprechen hat.
»Hi«, grĂŒĂt sie.
»Hi!«
»Heâs a backpacker! And heâs sleeping on couches â like you«, teilt die GroĂmutter die Info sofort.
»Really?«
Ich nicke.
»I would offer you my couch if I lived here«, lÀchelt mich die alte Dame an. Die Frau ist zu putzig.
»I already have one. Thank you. And Iâm not alone.«
Cari winkt uns vom Beifahrersitz aus zu.
»Well, it was nice meeting you. Safe travels!«
»Merry Christmas.«
Connor will mit uns in eine Brauerei und ein paar Bierchen trinken. Shelley sitzt auf dem Beifahrersitz. Die Art und Weise, wie sie mit Connor redet, wirkt sehr vertraut. Fast so, als seien sie ein Paar. Das ist aber einfach nur Shelleys Art, die ziemlich cool und souverĂ€n rĂŒberkommt. Connor steht ihr da in nichts nach. Er ist von der Sorte Mensch, der man ohne BerĂŒhrungsĂ€ngste entgegentreten kann, auf Anhieb entspannte Unterhaltungen fĂŒhrt und den man einfach mögen muss. Die Brauerei ist geschlossen: Christmas Eve. ZurĂŒck bei Connor hacke ich Holz fĂŒr den Kamin, wĂ€hrend Connor den Kopf in ebendiesen steckt und das Feuer durch krĂ€ftiges und rhythmisches Pusten neu entflammt. Der Mann weiĂ, wie man ein anstĂ€ndiges Feuer macht. Wir sitzen wieder in gemĂŒtlicher Runde beisammen. Ich erzĂ€hle den drei Amis, dass in Deutschland Heiligabend und nicht der erste Weihnachtsfeiertag im Zentrum steht. Das finden sie ziemlich schrĂ€g.
»How do you celebrate Christmas in Germany?«
»Pretty much the same as you do, I guess.«
Ich erzĂ€hle ihnen, dass wir uns ebenfalls einen Tannenbaum ins Wohnzimmer stellen und auch viele ihre HĂ€user schmĂŒcken. Dass wir keine WeihnachtsmĂ€nner im Supermarkt sitzen haben, dafĂŒr aber WeihnachtsmĂ€rkte mit GlĂŒhwein in den InnenstĂ€dten eröffnen. Der christliche Hintergrund der Feiertage spielt bei den meisten Menschen gar keine oder keine sonderlich groĂe Rolle mehr. Der Konsum regiert. Meine Familie ist auch atheistischer oder agnostischer Natur â auch wenn mein Vater jetzt: »Oh! Moment, Moment!«, protestiert, wenn er das liest. Ist doch so, Papa. Wir feiern an Weihnachten eher das Zusammenkommen der Familie. Am frĂŒhen Mittag fahren wir in den Heimatort meiner Mutter. Dort wird seit einigen Jahren auf dem Dorfplatz bei der Kirche GlĂŒhwein gegen Spenden ausgeschenkt und der örtliche Posaunenchor untermalt das Ganze mit weihnachtlicher Musik. Dementsprechend lustig gehtâs bei uns dann schon beim Mittagessen zu. Am Abend sind wir dann in der Regel alle sehr entspannt.
»Iâll show you how Germans celebrate Christmas«, grinse ich, packe mein deutsches Handy aus, schalte die Freisprechfunktion ein und rufe bei meinen Eltern an. Ich wollte heute sowieso mal anrufen. Hoch erfreut hebt meine Mutter den Hörer ab: »Dennis! Schatz! Boah, wir sind schon so besoffen. Der Marc hat heute eine ordentliche Mischung ausgeschenkt.«
Es geht um den Undenheimer GlĂŒhwein.
»Es ist ja auch schon ⊠Àhm ⊠es ist noch ziemlich frĂŒh, Mama! Ăbrigens: You have to speak English. America is listening.«
»Oh, hello America!«
Sie lacht laut.
Im Hintergrund ruft mein Vater: »America! Hello Houston! How ⊠Àhm ⊠merry ⊠happy!«
Er tut so, als könne er kein Englisch. Alle lachen â diesseits und jenseits des groĂen Teichs.
»Wie gehtâs dir denn? Und wo bist du?«
»Excuse me?«
Meine Mutter stöhnt auf: »How are you? Where are you?«
Ich erzĂ€hle ihr kurz, dass ich auf Endor bei den Ewoks bin, derzeit mit Cari reise und bei Connor ĂŒbernachte.
»Oho! Cari!«, animiert mein Vater den Rest der Familie. Die Witzbolde setzen alle mit ein: »Oooh!«, und brechen in kollektives GelĂ€chter aus, das einmal mehr auch in Eureka fĂŒr groĂe Erheiterung sorgt.
»Mario«, das ist mein Schwager, »hat dich heute vermisst. Weil du nicht da warst, musste er doppelt so viel GlĂŒhwein trinken.«
Wieder schwappt eine Welle grölenden GelĂ€chters durch den Hörer. Meinen Schwager höre ich aus dem Hintergrund kurz mit: »Ăh«, protestieren.
»Wer ist denn das?«, höre ich meine 90-jÀhrige Omi.
»Der Dennis, Omi! Der ruft aus Amerika an!«
»Ach, Gott.«
Obwohl Cari, Shelley und Connor das meiste nicht verstehen, bekommen sie einen ziemlich guten, wenn nicht sogar optimalen Eindruck davon, dass Weihnachten bei Knickels durchaus eine ziemlich lustige Veranstaltung ist.
»Yeah, thatâs how we celebrate Christmas in my family«, resĂŒmiere ich, nachdem ich aufgelegt und einen wichtigen Beitrag zur VölkerverstĂ€ndigung geleistet habe. Kommt gut an.
Connor stopft wieder sein Pfeifchen und erzÀhlt uns, dass hier das beste Gras wÀchst. Ich hole daraufhin mein Gras, das ich aus Washington mitgebracht habe, aus meinem Rucksack und gebe es Connor, damit er damit die nÀchste Pfeife stopfen kann: »I actually brought some legally grown weed from Washington.«
»Nice. This is organic Humboldt Weed.«
Connor hebt stolz das Pfeifchen in die Luft und greift dann nach dem TĂŒtchen, das ich ausgepackt habe. Er öffnet es, riecht daran und fĂŒllt es mit dem Biogras aus Eureka auf: ein Geschenk des Gastgebers. Sehr nett.
Shelley berichtet von ihrer Wanderung, Connor vom Rafting und auch Cari und ich erzĂ€hlen von unserem Tag im Wald. Das alles mit einer Tasse Tee, Kaminfeuer, Connors Pfeife und dem ulkigen kleinen Holiday Tree hinter uns. GemĂŒtlich. Um 22 Uhr muss Connor allerdings zur Arbeit: Heute Nacht werden Lachse markiert und gezĂ€hlt. Er lĂ€dt uns ein mitzukommen. Cari und ich mĂŒssen morgen aber schon sehr frĂŒh aufbrechen. Wir mĂŒssen den Wagen bis morgen Mittag, spĂ€testens 13 Uhr in San Francisco abgeben. Da wir planen, nicht den direktesten Weg, sondern den wohl ziemlich imposanten KĂŒstenhighway 1 entlangzutuckern, kann es gut und gerne sieben Stunden dauern, bis wir in San Francisco ankommen. Connor wird bis in den Morgen hinein an der LachszĂ€hlstelle arbeiten. Daher kĂŒndigen wir an, jetzt schlafen zu gehen und vermutlich heute Nacht, wenn wir aufbrechen wollen, noch einmal einen kurzen Abstecher zu ihm zu unternehmen.
Ich frage Shelley, ob sie auch plant, bald ins Bett zu gehen.
»Yes, but I go with Connor.« Ein kurzer Moment der Stille entsteht. »Uhm, not to bed ⊠to work.«
Als die beiden weg sind, erzĂ€hlt mir Cari, dass ich die beiden vorhin etwas irritiert habe. Wie das? Ich hĂ€tte auf Connors Frage, wie es im Wald war mit: »It was funny«, geantwortet. Okay? Laut Cari wird durch diesen Satz die Erwartung einer amĂŒsanten Geschichte geweckt. Richtig wĂ€re: »It was fun«, gewesen. Aha. Da wir ja nun schonungslos Tacheles reden, weise ich Cari wiederum darauf hin, dass sie immer von: »me and Dennis«, gesprochen hat. Wohlerzogen, wie ich nun einmal bin, erklĂ€re ich ihr: »Only the donkey names himself first.«
Sie schaut mich mit einem fiesen Blick an und wĂ€re nicht Cari, wenn nicht sofort ein Konter kĂ€me: »âșOkey-dokeyâč is not really considered to be cool.«
Ah! Das sitzt: »Well, I sort of know that itâs not really cool, but âŠÂ«
Sie lacht mich aus. Ich kann da aber nichts fĂŒr! Als wir »Erinnerungen« gedreht haben, arbeiteten wir mit einem ĂŒbermĂ€Ăig gut gelaunten und lustigen Bestatter zusammen, der immerzu: »Okey-dokey«, sagte. »Okey-dokey, MĂ€nners. So wirdâs gemacht.«
Das war ansteckend und auf seine Weise durchaus lĂ€ssig, versuche ich Cari von der subtilen Coolness im offensichtlich Uncoolen zu ĂŒberzeugen. Ein Stilmittel, sozusagen. Jetzt lacht sie noch lauter: »In your face!«
Schachmatt. Verdammt.
Da wir nun alleine im Haus sind, können wir es uns vor dem Kamin gemĂŒtlich machen. Wir legen noch etwas Holz nach und breiten Caris Decke vor dem Kamin aus. Romantischer gehtâs kaum. Nachdem wir letzte Nacht im zweiten Wohnzimmer ordentlich gefroren haben, beschlieĂen wir heute Nacht im Kaminzimmer zu schlafen. Als das Feuer erlischt, schmiegen wir uns zum Schlafen auf einen Sessel. Es ist wunderschön kuschelig. Ich könnte Cari ewig im Arm halten âŠ
We picked up our things. I lit a cigarette, feeling completely and utterly filled to the brim with satisfaction with life that day.







































































